|
|
Marina am 3. Mai 2019 13:08 In der Kürze liegt die Würze. Dieses schöne Sprichwort trifft auf viele Lebenslagen zu, im Besonderen aber auf die absurd-lustige Kammeroper L’heure espagnole von Maurice Ravel und Franc-Nohain, die 1911 in Paris uraufgeführt wurde und am vergangenen Sonntag auf der Studiobühne des Gärtnerplatztheaters Premiere feiert.
 Foto: Adrienne Meister Zentrum dieses Stücks ist die schöne Concepción, Gattin des Uhrmachers Torquemada, der einmal in der Woche eine Stunde lang die Rathausuhren warten muss und ihr so Zeit gibt, abwechselnd einen ihrer Liebhaber im Laden zu empfangen. Dummerweise taucht an diesem Tag der Mauleseltreiber Ramiro auf, der seine Uhr reparieren lassen muss und will im Uhrmachergeschäft auf Torquemada warten. Als Concepcións Liebhaber, der Poet Gonzalvo auftaucht, bittet sie Ramiro eine schwere Uhr die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer zu schaffen. Als dummerweise auch noch ihr zweiter Verehrer Don Inigo erscheint, versteckt sie Gonzalvo in einer Standuhr und lässt Ramiro diese hinauf schleppen. So werden abwechselnd die beiden Liebhaber in das Schlafzimmer der Dame geschmuggelt, bis diese Gefallen an dem starken Ramiro findet und ihre beiden – noch immer in Uhren versteckten – Besucher alleine im Geschäft stehen lässt, wo sie von Torquemada entdeckt werden.
 Foto: Adrienne Meister Ich kannte ja das Stück bereits aus einer anderen Inszenierung und war sehr gespannt, wie Regisseur Lukas Wachernig dieses amouröse Verwirrspiel auf der kleinen Studiobühne inszenieren würde. Er setzt dabei vollkommen auf die Absurdität der Kurz-Oper, was optisch durch die Ausstattung von Stephanie Thurmair unterstützt wird. Die Bühne erinnert stark an die surrealistischen Gemälde des spanischen Künstlers Salvador Dalí, vor allem die schmelzenden Uhren, die die drei Liebhaber anfangs über einen dürren Baum hängen. Der Uhrmacher Torquemada selbst erinnert dabei mit dem ikonischen gezwirbelten Bart an den berühmten Künstler.
Die Kostüme der fünf Solisten passen perfekt in das bunte Bühnenbild. Concepción trägt ein rotes Kleid im Stil der 20er Jahre, passend dazu ist auch ihr zukünftiger Liebhaber Ramiro in Rot- und Orangetönen gekleidet und sieht aus wie ein Muskelmann, wie man ihn früher auf Jahrmärkten sehen konnte. Gonzalvo und Inigo sind dagegen vorwiegend in kühlem Blau gekleidet. Auch das Makeup passt bis ins kleinste Detail zu diesen Kostümen und den überspitzten Charakteren. Ramiro und Gonzalvo bekommen beide ein Brusthaar-Toupet verpasst und letzterer erinnert nicht nur durch das Makeup sondern auch in seinen selbstverliebten Reden an den aktuellen amerikanischen Präsidenten.
Wachernig setzt in seiner absurden Inszenierung vor allem auf Slapstick und eine eindeutige Zeichnung der Charaktere, was zu dem schrägen Stück durchaus passt und somit beim Publikum für viele Lacher sorgt.
 Foto: Adrienne Meister Valentina Stadler gibt als Concepción eine verwöhnte Zicke, die die Uhren ihres Gatten sabotiert und nur ihr persönliches Vergnügen im Sinn hat. Es macht großen Spaß zuzusehen, wie sie mit den vier Männern spielt und die Aufmerksamkeit genießt, die sie ihr entgegen bringen. Ramiro wird von Matija Meić wundervoll als „Poser“ verkörpert, der der schönen Frau vom ersten Moment an mit seinen Muskeln imponieren will. Er ist fast permanent auf der Bühne und kämpft im Hintergrund mit dem Transport der Standuhren – der in dieser Inszenierung sehr kreativ gelöst ist – oder muss sich am Erste-Hilfe-Kasten der Probebühne bedienen, um seine Rückenschmerzen zu kurieren. Juan Carlos Falcón als Torquemada scheint hier als typisch verpeilter Künstler, der offenbar mehr Liebkosungen für seine Uhren und sein Werkzeug übrig hat als für seine Frau. Dieser Ansatz macht es dann auch irgendwie verständlich, dass die junge Concepción bei anderen Männern ihr Liebesglück sucht. Gyula Rab darf als etwas egozentrischer Poet Gonzalvo alles an Schmalz auspacken, was eine Tenor-Rolle zu bieten hat und zeigt so vor allem eine schöne Parodie auf die typischen Frauenhelden in anderen Opern. Der reiche Geschäftsmann Don Inigo Gomez wird vom Bass Christoph Seidl gespielt. Er möchte für seine junge Geliebte auch etwas weniger ernst wirken und tarnt sich deshalb als eine Uhr, die aus einem überdimensionalen Auge besteht, mit seinem Gehstock als Pendel.
Der Spaß, den die Solisten angesichts ihrer Charaktere an den Tag legen, hat sich sehr schnell auf meine Begleiterin und mich übertragen. Auch gesanglich meistern sie die fließende, sicher nicht ganz einfache, Musik perfekt. Das kleine Orchester unter der Leitung von Kiril Stankow sitzt hinter dem leicht durchsichtigen Bühnenbild und auch sie lassen den Raum mit den Klängen Ravels schweben, sodass die fast einstündige Spielzeit wie im Flug vorüber geht.
Der große Applaus am Ende war für alle Beteiligten voll und ganz verdient, denn diese Inszenierung macht einfach großen Spaß. Die Tatsache, dass Publikum hier ganz nah am Geschehen ist und auch ab und an einbezogen wird, ist nach wie vor ein großer Pluspunkt der kleinen Studiobühne.
Musikalische Leitung: Kiril Stankow
Regie: Lukas Wachernig
Bühne / Kostüme: Stephanie Thurmair
Licht: Michael Heidinger
Dramaturgie: Daniel C. Schindler
Concepción: Valentina Stadler
Gonzalvo: Gyula Rab
Torquemada, Uhrmacher: Juan Carlos Falcón
Ramiro, Mauleseltreiber: Matija Meić
Don Inigo Gomez: Christoph Seidl
weitere Termine: 6. / 8. Mai / 19. Juni, 19.30 Uhr und 20. Juni, 18.00 Uhr
https://www.gaertnerplatztheater.de/de/produktionen/heure-espagnole.html?m=362
Ähnliche Artikel
Marina am 25. April 2019 09:48 Dem Genre Musical haftet ja heute oftmals das Vorurteil an, dass es seichte Unterhaltung für die ganze Familie sei. Das liegt natürlich nicht zuletzt daran, dass die großen privaten Musicaltheater in Deutschland tatsächlich auch genau darauf setzen. Da ist es natürlich schön, dass vor allem die öffentlichen Theater durchaus immer häufiger Werke abseits des Mainstream auf den Spielplan setzen. Avenue Q ist eines dieser Stücke: im englischsprachigen Raum durchaus ein großer Erfolg wurde dieses Stück in Deutschland bisher eher selten gezeigt. Das Plakat des Landestheaters Niederbayern kommt dabei mit den bunten Puppen und grellen Farben durchaus anziehend für Kinder daher, würde nicht groß „FSK 18“ darauf prangen. Tatsächlich ist das Musical von Robert Lopez, Jeff Marx und Jeff Whitty nämlich alles andere als jugendfrei.
 Foto: Peter Litvai Auf den ersten Blick erinnert es dabei sehr an die Sesamstraße, mit der wohl die meisten auch bei uns in Deutschland aufgewachsen sind: In einer Nachbarschaft treffen menschliche Charaktere und Puppen aufeinander, es werden fröhliche Lieder gesungen… aber schnell stellt sich heraus, dass man in der Avenue Q weitab vom Idyll der Sesamstraße oder Muppets ist. Hier wohnen Menschen und Monster, die in New York durch das soziale Raster gefallen und vor allem pleite sind. Der frische Uni-Absolvent Princeton findet hier eine billige Bleibe und wird durchaus freundlich in die neue Nachbarschaft aufgenommen. Vor allem seine reizende Nachbarin, das Monster Kate, hat es ihm schnell angetan. Der Hausmeister ist der ehemalige Kinderstar Gary, dessen Eltern sein ganzes Geld verprasst haben. Dann gibt es noch eine ungleiche Männer-WG, die sehr an Ernie und Bert aus dem
 Foto: Peter Litvai Kinderfernsehen erinnern. Nicky und Rod sind jedoch weitaus weniger harmonisch, vor allem weil der gutmütige aber chaotische Nicky seinen peniblen Mitbewohner endlich dazu bringen will sich zu outen. Auch das beliebte Krümelmonster scheint hier einen Verwandten zu haben: der heißt Trekkie, hat aber anstatt einer Keks-Sucht eine Vorliebe für Internet-Pornos. Und dann sind da noch die beiden putzigen Bullshit-Bären, die die Bewohner der Avenue zu Alkoholismus, betrunkenem Sex und anderen fragwürdigen Aktionen verleiten wollen.
Stefan Tilch zeigt in seiner Regiearbeit angesichts dieser Voraussetzungen großen Mut zur Respektlosigkeit. Wie selbstverständlich werden rassistische Witze zum Besten gegeben und (Puppen-)Sex auf der Bühne gezeigt. Trotz der meist vorherrschenden guten Laune schafft der Regisseur es jedoch, bei den Charakteren eine tiefe Frustration angesichts ihrer Situation durchscheinen zu lassen. Und vor allem erinnert die Inszenierung trotz der erwachsenen Themen im Spiel der Darsteller noch immer an die Sesamstraße.
Die Bühne von Beate Kornatowska zeigt einen versifften Straßenabschnitt, in den man sich im wirklichen Leben nicht unbedingt verirren möchte. Im Laufe der Inszenierung wächst der Müllberg, für den sich keiner zuständig zu fühlen scheint und alles scheint, als könnte es einen neuen Anstrich gebrauchen. Die Band unter der Leitung von Basil Coleman ist hinter der Jalousie eines geschlossenen Ladens versteckt und so ab und an auch zu sehen. Die Band begleitet die Sänger mit viel Schwung und erfreulicherweise auch von den Lautstärken sehr gut abgestimmt, sodass man die Solisten gut verstehen kann. Ein kleiner Wehrmutstropfen war im Theaterzelt, dass die laute Musik vom Circus Krone, der gerade einige hundert Meter weiter seine Zelte aufgeschlagen hat manchmal in stilleren Szenen zu hören war. Da hätten die temporären Nachbarn etwas mehr Rücksicht auf das (im Moment wegen Renovierungsarbeiten ausquartierte) Stadttheater nehmen können.
Dass diese schrägen Charaktere eine unterhaltsame und spannende Geschichte erzählen ist fast klar und so düster wie es die heruntergekommene Umgebung vielleicht vermuten lässt ist es dann auch tatsächlich nicht. Einige Figuren wie der jüdische Möchtegern-Comedian und die japanische Therapeutin Christmas Eve finden trotz Streitereien schnell ihr Glück. Auch für Princeton und Kate sieht es anfangs nach einer heißen Liebesnacht gut aus, doch wird ersterer von der Torschlusspanik erfasst und lässt sich daraufhin mit der Pornodarstellerin Lucy ein. Doch trotz mancher Rückschläge zeigen alle Charaktere am Ende, dass sie doch zusammenhalten und so gibt es dann doch irgendwie für jeden ein Happy End.
Das Spiel mit den Handpuppen, die stilistisch Jim Henson nachempfunden sind (und der neben den Muppets unter anderem auch am Film Der kleine Horrorladen und der beliebten Serie Die Dinos beteiligt war) ist natürlich die größte Besonderheit dieses Stücks. Während man jedoch in der Regel in Film und Fernsehen die Puppenspieler nicht sieht stehen sie in diesem Musical ebenso im Zentrum wie ihre Charaktere. Manchmal kann man sich als Zuschauer gar nicht entscheiden, ob man jetzt die Puppen oder die Sänger beobachten, vor allem weil die Mimik dieser oftmals schlichtweg grandios ist! Am meisten zu tun hat dabei Reinhard Peer, der den chaotischen Nicky, das versaute Trekkie-Monster und einen der bösartig-niedlichen Bullshit-Bären spielt. Vor allem stimmlich sind diese drei Charaktere so grundverschieden, dass man zunächst vielleicht gar nicht merkt, dass es ein und derselbe Darsteller ist. Eine wundervolle, kraftvolle Gesangsstimme zeigt Catherine Chikosi sowohl als brave Kate als auch als frivole
 Foto: Peter Litvai Lucy, auch sie schafft es, den beiden Frauen nicht nur stimmlich sondern auch in ihrer Körperhaltung und Mimik eine ganz eigene Charakteristik zu geben. Hauptdarsteller Julian Ricker gibt neben dem sympathischen Idealisten Princeton auch den spießigen Rod. Durchaus spannend wird es, wenn mehrere Puppen desselben Darstellern auf der Bühne sind. Das Spiel übernimmt in diesem Fall ein anderes Ensemblemitglied, während die Stimme noch vom Darsteller kommt. Besonders interessant ist es hier etwa, wenn Stefan Sieh die Puppe von Lucy übernimmt und dann dazu passend laszive Mimik und Bewegungen zum Besten gibt.
Besonders spannend ist jedoch wirklich das Zusammenspiel der Protagonisten aus Plüsch mit ihren menschlichen „Nachbarn“. Sarah Est gibt mit Christmas Eve eine wundervoll unkorrekt Klischee-Asiatin, die vor allem ihrem Partner Brian gegenüber sehr herrschsüchtig ist und im nächsten Moment wieder engelsgleich die Therapeutin mimt. Zu dieser stereotypen Erscheinung trägt vor allem auch das Kostüm von Beate Kornatowska bei, die meines Wissens neben den „Großen“ auch die Puppen einkleidete. Dem Komiker Brian gibt David Lindermeier eine wundervoll entspannte und sympathische Ausstrahlung, die auch bei den Wutausbrüchen von Eve selten ins Wanken gerät. Mona Fischer zeigt als ehemaliger Kinderstar Gary Coleman eine rockige Gesangsstimme und vor allem eine unerschütterliche Lässigkeit und positive Grundeinstellung. Und das, obwohl die Bewohner der Avenue sich schon zu Beginn des Stückes einig sind, dass er das schlimmste Schicksal von allen hat.
Zusammenfassend muss man wirklich das gesamte Ensemble bewundern, das Zusammenspiel funktioniert wundervoll und so wurde es mir im Publikum keine Sekunde langweilig. Vor allem hat mich fasziniert, dass einige Handpuppen wie Nicky und Trekkie von zwei Darstellern gleichzeitig gespielt wurden. Dass sich die bei den Choreografien nicht gegenseitig auf die Füße treten ist bemerkenswert.
Wer erwachsenen Humor und ungewöhnliche Musicals mag wird an Avenue Q wahrscheinlich große Freude haben! Noch gibt es zwei Möglichkeiten, die schräge Inszenierung im Mai in Passau zu sehen, was ja vor allem von München aus auch bequem mit der Regionalbahn zu erreichen ist 😉
Weitere Termine:
3. und 4. Mai 2019, 19.30 Uhr im Stadttheater Passau
https://www.landestheater-niederbayern.de/events/285
Princeton / Rod: Julian Ricker
Brian: David Lindermeier
Nicky / Trekkie Monster / Bullshit-Bär: Reinhard Peer
Neuankömmling / Ensemble: Stefan Sieh
Gary Coleman: Mona Fischer
Christmas Eve: Sarah Est
Kate Monster / Lucy: Catherine Chikosi
Bullshit-Bär / Frau Semmelmöse / Ensemble: Elena Otten
Ensemble: Susanne Prasch
Regie: Stefan Tilch
Musikalische Leitung: Basil Coleman
Ausstattung: Beate Kornatowska
Choreografie: Susanne Prasch
Puppen: Birger Laube
Puppen-Coaching: Dennis M. Rudisch
Videos: Florian Rödl
Dramaturgie: Dana Dessau
Ähnliche Artikel
Stefan am 17. April 2019 23:42  Ulrike Dostal als Lola Blau © Thomas Trüschler Georg Kreisler, der sonst im Park Tauben vergiften geht, hat 1971 ein Musical für eine Darstellerin geschrieben, das bestimmt auch autobiografische Züge trägt.
Worum geht es? Wien. 1938. Ein Zimmer bei einer möblierten Wirtin. Eine junge Schauspielerin – Lola Blau – auf dem Weg zu ihrem ersten Engagement. Telefonanrufe. Der Onkel auf dem Weg nach Prag. Der Freund auf dem Weg nach Basel. Der Führer feiert den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich. Die Schauspielerin interessiert sich nicht für Politik. Sie freut sich auf ihr Engagement. Doch der Theaterdirektor sagt ihr kurzfristig ab, die möblierte Wirtin hat schon die neue Fahne rausgehängt und „bittet“ Lola Blau umgehend das Zimmer zu räumen. Und so beginnt ihre Odyssee. In Basel trifft sie ihren Freund nicht. In Zürich wird sie ausgewiesen. Sie hat Glück, reist per Schiff in USA, kann Karriere machen. Nach dem Krieg hört sie von ihrem Freund. Statt nach Basel ging seine Reise nach Dachau. Sie kehrt zurück nach Wien. Der Rassenwahn ist vorbei. Eine österreichische Dame wurde nur Deutsche, denn sie hatte nicht das “Glück” als Jüdin nach Übersee zu gehen.
Ulrike Dostal verkörpert in diesem Ein-Frau-Musical die Lola Blau, die von der einfältigen jungen Frau über die ungewünschte Asylantin zum gefeierten Star mit viel Erotik wird und erkennen muss, dass ihre früheren Nachbarn statt ihrer eigenen Schuld nur Selbstmitleid und weitere Ausgrenzung kennen. Diese 10 Jahre Reifung konnte ich unmittelbar spüren. Genauso übertrugen sich die Gefühle. Dazu kamen großartige Songs, die genau zu den Lebensabschnitten passten, wie der Song über die Damen der ersten Klasse auf dem Ozeanriesen wie auch das Lied für die jiddischen Flüchtlinge im Unterdeck. Oder der Marlene-Dietrich-Verschnitt als alkoholgetränkter blauer Engel. Unter die Haut gingen erst recht die Worte, die von Wiener Melodien begleitet waren.
Robert Ludewig hat in seiner Inszenierung die Handlung mit Filmausschnitten zur Geschichte angereichert. So wurde die Handlung noch verständlicher.
Am Klavier wurde Ulrike Dostal von Lutz Müller-Klossek begleitet.
Weitere Vorstellungen:
28.04.2019 20:00 Uhr
15.06.2019 20:00 Uhr
16.06.2019 20:00 Uhr
Pasinger Fabrik
August-Exter-Str. 1, München
Karten VVK oder 089 82929079 (18,-)
Ähnliche Artikel
Stefan am 14. April 2019 23:09 
Sophie Mitterhuber (Nadina), Daniel Prohaska (Bumerli)
© Christian POGO Zach
Ohne Männer hat das Leben keinen Zweck…
… beklagen die drei zurückgelassenen Frauen im Haus des bulgarischen Oberst Popoff. Sind doch Ehemann der Hausherrin sowie Bräutigam der Tochter Nadina und gleichzeitig heimliche Liebe deren Zofe Mascha im Feld. Findet doch gerade der serbisch-bulgarische Krieg statt. Während Nadina vom Held ihrer Träume schwärmt, wird Mascha, die als arme Cousine, ins Haus aufgenommen wurde, darauf hingewiesen, dass genau dieser pekuniäre Zustand dazu führen muss, dass der Held für Nadina und nicht sie bestimmt ist. Wenn man kein Geld hat, darf man sich halt auch seine Träume abschminken. Aber da landet schon ein flüchtender Soldat auf dem Balkon vor Nadinas Schlafzimmer. Es ist Bumerli, ein Schweizer in serbischen Diensten, der seine Schoggi mehr mag als Patronen. Doch eine bulgarische Einheit ist ihm auf den Fersen. Er wird versteckt und die drei Damen haben ihr Abenteuer. Gatte und Bräutigam kommen heim. Auch Bumerli ist wieder zur Stelle. Das nächtliche Abenteuer muss vertuscht werden. Das funktioniert solange, bis auch der Hauptmann auftaucht, der Bumerli am ersten Abend verfolgte, und ihn erkennt. Nadinas Bräutigam erkennt den Betrug seiner Verlobten und kann sich nun Mascha zuwenden. Und Bumerli ist aufgrund seines Reichtums der ideale Schwiegersohn. Nur Nadina ist verschwunden. Shaws Schauspiel über den Krieg wurde urheberrechtsverletzend von Oscar Straus genial vertont. Ein ernstes Thema in Komödie verpackt mit heiterer Musik. Diese Auseinandersetzung mit dem Militarismus muss 1908, als das Werk auf die Bühne kam, radikal gewirkt haben, sehnten sich doch viele nach einem „reinigenden Gewitter“. Und der schneidige Offizier in funkelnder Uniform war immer hübsch anzusehen. Um diese Wirkung ins heute zu bringen, muss man übertreiben, grotesk werden. Peter Konwitschny verlegt die Handlung auf eine fast leere Bühne. Nur wenige notwendige Möbelstücke sind vorhanden, wenn sie benötigt werden, mal ein Bett oder ein paar Stühle. Also muss das fantastische Ensemble den Raum füllen. Das gelingt jedes Mal aufs Neue perfekt. Alle Personen entwickeln Persönlichkeiten. Man kann über sie lachen, obwohl vieles zum Weinen wäre. Und sie lassen sich von ihren Werten nicht abbringen, auch wenn die Welt um sie herum in Trümmern liegt. Mit dieser Inszenierung hat das Gärtnerplatztheater wieder eine Operette gezeigt, wie sie ursprünglich gedacht war. Heiter, witzig, mit ganz viel zum Nachdenken über uns und die Welt und einem Schuss Erotik…
Schade, das Werk bald wieder von Spielplan verschwindet.
Buch von Rudolf Bernauer und Leopold Jacobson
Mit Benutzung von Motiven aus Bernhard Shaws »Helden«
Musik von Oscar Straus
Premiere am 14. Juni 2018
Altersempfehlung ab 13 Jahren
Chor des Staatstheaters am Gärtnerplatz
Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz
Die letzten Termine:
Sa 20.04.2019 19.30 Uhr
So 21.04.2019 18.00 Uhr KiJu
Ähnliche Artikel- Premiere “Der tapfere Soldat”, 14.06.2018, Gärtnerplatztheater
- Uraufführung Drei Männer im Schnee, 31.01.2019, Gärtnerplatztheater
- Dantons Tod, 13.10.2018, Gärtnerplatztheater
- Pumuckl, 07.05.2018, Gärtnerplatztheater
- Uraufführung Pumuckl – Das Musical, 19.04.2018, Gärtnerplatztheater
Corinna Klimek am 5. April 2019 22:48  Ulrike Dostal als Lola Blau © Thomas Trüschler Im März 1938 flieht die jüdische Schauspielerin Lola Blau aus ihrer Heimat Österreich, die sich Nazi-Deutschland angeschlossen hat, und erreicht über Umwege die USA. Dort erlangt sie eine gewisse Berühmtheit als Sängerin und Sexsymbol, kommt aber nie wirklich in der neuen Welt an. Nach dem Ende des Kriegs entschließt sie sich zu einem Neubeginn in der alten Heimat, wo sie, mit den alten Dämonen konfrontiert, feststellen muss, dass sie auch hier ihr Glück nicht finden wird.
Das erfolgreiche „Einpersonen-Musical“ mit seinen melancholischen, komischen und mitunter bissigen Chansons zählt zu den erfolgreichsten und meistgespielten Stücken des unvergleichlichen Georg Kreisler.
1971 uraufgeführt, hat es nichts von seiner Aktualität verloren. Ist der Sex-sells-Mechanismus des Showbusiness seither vielleicht sogar noch angewachsen, wirkt der Antisemitismus eher im Verborgenen noch immer weiter. Und so gilt das Vorwort Kreislers bis heute: „Jeder Mensch muß vor allem versuchen, die Hindernisse die die Sonne verstellen, für sich und seine Mitmenschen aus dem Weg zu räumen.“
Premiere: 13.04.2019 weitere Aufführungen: 14.04. + 28.04.
Pasinger Fabrik
August-Exter-Str. 1, 8125 München
Tickets: 18,- €
Tel. 089 – 82 92 90 79 oder MünchenTicket
Besetzung:
Ulrike Dostal als Lola Blau
Lutz Müller-Klossek am Piano
Regie:
Robert Ludewig
Kostüme:
Ulrike Aberle
Bühne:
Robert Ludewig
Ähnliche Artikel
ottifanta am 3. April 2019 23:27  Foto ©ottifanta Die Stimmung war positiv gespannt im fast ausverkauften Brunosaal in Köln als Takis Würger und Adriana Altaras die Bühne betraten.
Die Veranstaltung begann direkt mit der im deutschen Feuilleton heiß diskutieren Frage „darf man das“. Darf man einen Liebesroman über eine deutsche Jüdin schreiben, die andere Juden an die Gestapo verriet. Adriana Altaras selbst sei genau das oft gefragt worden und sie finde absolut, dass man das darf. In Stella und am heutigen Abend gehe es um Schuld, Liebe und Moral.
Dann stellte sie kurz Takis Würger vor, der 1985 geboren wurden und vielen vermutlich als der Autor von Der Club bekannt sei, das für Adriana Altaras ein „Hammerbuch“ ist. Er habe die Journalistenschule besucht, in Cambridge studiert und als Kriegsreporter gearbeitet.
In seinem neuen Buch geht es um Stella Goldschlag, die eine sogenannte Greiferin gewesen sei. Takis Würger findet den Begriff Greiferin unglücklich, es klinge für ihn zu schnittig. Seines Wissens hätten rund zehn Juden mit der Gestapo kollaboriert. Von einem Freund, der das Theaterstück Stella besuchte, hörte er zum ersten Mal von Stella Goldschlag. Eine gebildete, musische Jüdin, die in einer geheimen Jazzband spielte und 1943 mit ihren Eltern verhaftet wurde. Die Gestapo stellte sie dann vor die Wahl, ihre Eltern mit dem Zug nach Auschwitz fahren zu sehen oder mit der Gestapo zu kollaborieren. Sie entschied sich die Kollaboration und sei für den Tod von Hunderten von Juden verantwortlich. Das Theaterstück und der Film Die Unsichtbaren hätten sich bereits vor dem Roman mit Stella Goldschlag beschäftigt.
Für Adriana Altaras stellt sich hier die Frage nach der individuellen Schuld und was man selbst getan hätte. Ihrer Ansicht nach haben die Zeiten sich gewandelt. Zuerst seien Juden Opfer gewesen, dann sei die Phase gekommen „aber wir Deutschen haben auch gelitten, Dresden brannte usw.“ und dann, dass es auch böse Juden gab.
Ob man mit der Gestapo kollaborieren könne, sei eine sehr komplexe Frage und erst recht, warum Stella Goldschlag auch nach dem Tod ihrer Eltern weitermachte.
Takis Würger kann die Aufregung über sein Buch nicht recht verstehen, denn es sei bereits vor rund 25 Jahren ein Sachbuch über Stella Goldschlag erschienen, das jetzt neu aufgelegt wurde und auch das Musical wurde bereits im Sommer 2016 erstaufgeführt. Ihm selbst sei kein anderes Beispiel für böse Juden bekannt, Fälle in denen Juden Täter waren. Wieviel Mitschuld Stella Goldschlag getragen habe, sei für ihn ein wichtiges Thema.
 © Hanser Literaturverlage Adriana Altaras war schockiert, dass die Kritiken oft kaum an Häme zu überbieten waren. Auf der anderen Seite war Stella beim NDR “Buch des Monats” und die Jüdische Allgemeine habe es als „Leise, glaubwürdig und ja, auch schonungslos, aber an keiner Stelle unempathisch, effekthascherisch oder gar reißerisch” beurteilt.
Für sie sei der Eindruck entstanden, dass nur noch Juden über den Holocaust schreiben dürften, Maxim Biller, sie selbst und wenige andere. Wie sich Takis Würger die Häme erkläre? Seiner Meinung sei es am besten, wenn der Autor nichts dazu erkläre. Natürlich hoffe man als Autor, dass das Buch gut ankomme. Als das Buch und die Kritiken erschienen, habe er mit vielen Buchhändlern gesprochen, die diese Diskussionen im Laden führen mussten und das Echo sei sehr positiv gewesen.
Am Ende des Buchs steht seine persönliche Emailadresse und nach den vernichtenden Kritiken am 11. Januar, habe er habe Angst gehabt, in sein Postfach zu schauen. Es seien einigen Emails von Buchhändlern gewesen, die das Buch vor den Verrissen lasen, es gut fanden und ihm zur Seite standen. Er bedankte sich an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Buchhändlern für ihre Unterstützung. Insgesamt habe er rund 1300 Emails bekommen, von denen weniger als zehn verletzend gewesen seien. Viele hätten Kritik geäußert und es haben Diskussionen gegeben. Das größte Kompliment sei für ihn gewesen: „Ich habe Ihr Buch vor zwei Tagen fertig gelesen, aber ich noch lange nicht fertig damit.“
Sein Verleger und Lektor habe die Ansicht vertreten, dass sein Buch diese Debatte eigentlich nicht hergeben würde, was ihn wiederum amüsierte.
Dann las Takis Würger gekonnt das Kapitel, in dem Friedrich vorgestellt wird. Wie er in der Schweiz aufwächst und von seiner Mutter gedrillt wird, die ein einziges Ziel hat und ihn dafür schon früh an der Staffelei stellt. Es folgt ein einschneidendes Ereignis, das Friedrichs Leben für immer verändert.
Für Adriana Altaras ist es sehr wichtig, dass Friedrich immer die Wahrheit sagt, so wie er es von seinem Vater lernte. Als er sich jedoch in Stella Goldschlag verliebt, kann und will er vieles nicht sehen.
Takis Würger betont an dieser Stelle, dass Stella ein Roman ist, vorher sei über die historische Stella Goldschlag gesprochen worden und er wolle auf den Unterschied hinweisen, worauf Adriana Altaras lakonisch kontert, dass es ein Roman sei stehe doch vorne drauf.
Seiner Meinung nach verhalte sich Friedrich so, weil Stella Goldschlag die erste sei, die ihm das Gefühl gebe, so ok zu sein, wie er ist. Friedrich frage nicht nach, weil er um jeden Preis das erhalten wolle, was er gefunden hat. Ja, Friedrich sei sehr naiv, aber er reflektiere auch über Stella und Takis Würger zitiert eine kurze Stelle aus dem Roman „vielleicht habe ich gewusst…“. Vielleicht hätte er diese Stelle deutlich herausarbeiten sollen.
Adriana Altaras vermutet, dass die Kritiker so hysterisch seien, weil es Unterschiede zwischen dem Roman und der historischen Realität gibt.
Takis Würger hatte während des Schreibens auch Kontakt zu Professor Sascha Feuchter, Leiter der Stelle für Holocaustliteratur an der Uni Gießen. Dieser habe ihm die Frage gestellt, ob man im Jahr 2019 ernsthaft eine Debatte darüber führen würde, was Literatur dürfe. Es sei Kunst, die dürfe alles.
Wenn die Generation von Takis Würger nicht darüber schreibe, während die letzten Zeitzeugen noch leben, dann beginne die Zeit des Schweigens. Ob man darüber eine Liebesgeschichte schreiben könne und diese gelesen werde, könne man diskutieren. (Interessante Radiosendung mit Sascha Feuchter *klick*) Die Shoa sei so groß gewesen. Wenn sein Roman dazu führe, dass ein Einziger über dieses Thema google und sich dafür interessiere, sei er zufrieden.
Für Adriana Altaras ist ein Roman seiner Generation und sie findet es wichtig, dass die Generation der 30-40 Jährigen über die Zeit schreibt, statt damit aufzuhören, weil man nicht Primo Levi ist.
Ihrer Ansicht nach ist Friedrich extrem naiv. Sie kann scheinbar Takis Würgers Beteuerungen, dass nur Friedrich so naiv sei nur halbherzig Glauben schenken und wünschte sich deutlichere Aussagen dazu im Buch. Ihrer Ansicht nach sei er ausgewichen und sie hofft auf mehr im nächsten Buch.
Takis Würger fände es anmaßend, die Frage zu beantworten, was man selbst an Stella Stelle getan hätte. Er wünsche sich, dass die Leser selbst darüber nachdenken.
Dann las er jene Textstelle, in der Friedrich und Stella sich zum ersten Mal begegnen.
Im Buch sind zahlreiche Zeugenaussagen über Stella Goldschlag in kursiver Schrift abgedruckt, sowie immer wieder kurze Sammlungen zeithistorischer Informationen.
Ihm sei das Leben der Figuren wie ein Kammerspiel vor einer Luxuskulisse in Berlin vorgekommen, als ob die Nazis nicht gleichzeitig Krieg führen würden und Juden ermorden.
Die Zeugenaussagen seien sehr kalt und klar, sie würden deutlich zeigen, wie gefährlich diese Frau war. Durch die Chronikeinträge würden die Leser gezielt immer wieder aus der Geschichte geworfen. Dies sei lange im Lektorat diskutiert worden. Er wollte den Lesern etwas vom Inhalt der rund vier Dutzend Bücher über die 40er Jahre vermitteln, die er las, weil er selbst überrascht war, wie wenig er über diese Zeit wusste. Die Leser sollten erfahren, was alles passierte, während in Berlin diese Liebesgeschichte spielt. Während des unglaublichen Terrors der Nazis passierten auch unglaublich triviale Dinge, Oscar wurden verliehen, Opern aufgeführt usw. Für ihn sollten die Chronikeinträge illustrieren, dass das Leben weiterging.
Ihn fesselte das Tagebuchs eines US-Journalisten, der 1942 im Adlon lebte und nachts ein anderes Leben führte, der die geheimen Jazzclubs ging und von zwei französischen Kriegsgefangenen erzählt, die Wein aus Fässern auf Flaschen zogen, weil so viel Wein getrunken wurde. Er wollte zeigen, dass auch böse Menschen Feste feierten, u.a. auf der Wannseekonferenz.
Das Böse habe sehr viele Facetten. Bei seiner Recherche sei er immer wieder bei Reinhard Heydrich hängengeblieben. Sohn eines Komponisten, der selbst sehr musikalisch war, Violine spielte und von Musik oft zu Tränen gerührt wurde. Gleichzeitig habe er die Wannseekonferenz geplant und sei ein Monster gewesen. Heyrich habe er nicht in den Roman nehmen wollen, daher gebe es Tristan von Appen, der zunehmend bösartig sei und Nazi.
Adriana Altaras gefällt es, dass die Figuren mehrere Facetten haben und wünscht sich für den nächsten Roman noch vielschichtigere Figuren. Die historische Stella Goldberg sei nach dem Krieg in einem ersten Prozess zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt worden, nach ihrer Freilassung in einem zweiten Prozess später zu weiteren zehn Jahren, die jedoch als verbüßt galten. Sie habe erfolglos versucht, eine Rente als Opfer des Faschismus zu bekommen und sich später durch einen Sturz auf dem Fenster umgebracht. Ihre Tochter sei um die Zeit des ersten Prozesses von Berliner Juden adoptiert worden, die mit dem Kind nach Israel auswanderten. Die jüdische Gemeinde habe den Kontakt zwischen Mutter und Tochter später verhindert.
Dann erklärte Takis Würger, dass Stella Goldschlag ihre publizistischen Persönlichkeitsrechte vererben wollte. Dies sei jedoch nicht möglich, man könne nicht beeinflussen, wie nach dem Tod über einen geschrieben werde. Wenn man eine Person der Zeitgeschichte sei, sei es sowieso anders.
Ähnliche Artikel
Petra Schmidt am 1. April 2019 23:05 Die Münchner Schickeria spielt “Arme Künstler“ – zur Premiere von „La Bohème“ am Gärtnerplatztheater
 Liviu Holender (Schaunard), Lucian Krasznec (Rodolfo), Camille Schnoor (Mimì)
© Marie-Laure Briane Eine Altbauwohnung, die an Wänden und Boden mit schwarz-weißen Graffiti besprüht ist, selbst der große Kamin wird davon nicht verschont. Die Fenster sind ausgehängt und stehen an der Wand, so dass es hereinschneien kann. Die Männer-WG um Dichter Rudolfo und Maler Marcello singt von der Kälte, aber die nimmt man ihnen nicht so recht ab, bräuchten sie doch nur die Fenster wieder einhängen und sich in die Pelzdecke kuscheln, die auf dem Sofa liegt.
Was mit vielen Fragezeichen in meinem Kopf beginnt scheint dennoch die ersten beiden Bilder über zu funktionieren. Die Bohème ist nicht ein über 100 Jahre alter Zopf, Bohème ist jetzt und hier. Statt in die Vergangenheit zu führen holt Regisseur Bernd Mottl das Publikum in seiner Wirklichkeit ab. In dieser Boheme gibt es Tablets und Handys, eine schrille Szenekneipe und Fastfood. Krankheit gibt es heute auch, ungewöhnliche Lebensstile ebenso. Warum also nicht? Ungleiche Paare finden sich und versuchen ihre Beziehung zu gestalten. Dass da ein Apple-Pencil als „vermaledeite Feder“ durch den Raum fliegt, letzte Fotos per Tablet geschossen werden – all das passt irgendwie.
Faszinierend: die Bühnenumbauten vor Publikum – die Fensterfront fährt zurück, das Sofa versinkt im Boden und flugs wird aus dem Graffiti-Loft des ersten Bildes die Szenekneipe mit schrillen Gestalten inclusive als Christbaum verkleidetem Spielwarenhändler und strippendem Weihnachtsmann. Herausragend und passend zur Rolle ein wenig spitz gesungen die als Hobby-Domina gestylte Maria Celeng als Musetta. Grandios wickelt sie ihren Sugar-Daddy (Holger Ohlmann) um den kleinen Finger und flirtet, was das Zeug hält.

Matija Meić (Marcello), Levente Páll (Colline), Lucian Krasznec (Rodolfo), Christoph Filler (Schaunard)
© Marie-Laure Briane
Schwieriger wird es dann aber ab dem dritten Bild. Rudolfo und Mimi wollen sich trennen: Rudolfo weiß, dass Mimi schwer krank ist und weil er ihr nicht helfen kann und ihr nicht das Leben bieten kann, das sie verdient, rät er ihr, sich doch einen besseren, reicheren Freund zu suchen – was sie dann schließlich halbherzig auch tut. Ja, und das passt dramaturgisch so gar nicht: wenn diese Bohemiens gar nicht wirklich arm sind, sondern nur damit kokettieren, dann bräuchten sie ja bloß auf die reiche Verwandtschaft zurückgreifen oder auf Marcellos viele Geldscheine, die er mal eben so aus seiner Hosentasche zieht. Nein, das überzeugt mich keineswegs! Für mich liegt die Tragik und Sozialkritik des Stückes gerade in der Zumutung, dass armen Menschen der Zugang zu ärztlicher Versorgung mangels finanzieller Mittel versperrt bleibt – eine Realität des 19. Jahrhunderts, die wir heute gottlob so nicht erleben müssen.
Sängerische Highlights sind Camille Schnoor als Mimi, die wunderbar zart und zerbrechlich singen kann, aber auch eine kraftvolle Tiefe aufweist. Sie ist keine leidende Unterschicht-Arbeiterin, sondern ein durchaus selbstbewusstes Wesen, das sich der Schwere ihrer Krankheit vielleicht wirklich nicht bewusst ist. Herrlich gefühlvoll mit leichter, lockerer Höhe ihr Gegenpart, Lucian Krasznec. Habe ich schon öfter bei den Spitzentönen mit manchem Tenor mitgezittert (kriegt er ihn oder eher nicht…), letztens an der Lindenoper in Berlin, so schmelze ich hier nur so dahin. Dieser Rudolfo ist schwärmerisch, von zärtlicher Liebe ergriffen zu seiner Nachbarin und die Verzweiflung im letzten Bild bei ihrem Tod ist so intensiv gespielt, dass mir die Gänsehaut kam. Kein Geschmettere, keine Selbstdarstellung – das ist ein Rudolfo, wie er sein sollte!

Chor und Kinderchor des Staatstheaters am Gärtnerplatz, Statisterie
© Marie-Laure Briane
Auch die Kollegen der Männer-WG sind durchweg hervorragend besetzt, allen voran Matija Meić als Maler Marcello, der absolut glaubhaft macht, dass er von Musetta trotz einiger schwerwiegender Differenzen nicht loskommt.
Das von Chefdirigent Antony Bramallsouverän geführte Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz zeigt alle Nuancen von Puccinis bildhafter Musik. Dass diese Transparenz und Farbigkeit gelingt, mag auch an der – wie ich finde hervorragenden – neuen Aufstellung des Orchesters liegen. Endlich hört man die Holzbläser klar und auch die Hörner kommen besser zur Geltung als unter der Bühne im Eck. Lediglich die Harfe ist mir noch etwas zu unscheinbar und wenig prägnant, was an ihrer unglücklichen Positionierung im Graben liegen mag.
Fazit: eine interessante, aber für mich nicht durchgehend stimmige Interpretation der Regie, aber musikalisch ein absoluter Leckerbissen, den sich Puccini-Freunde nicht entgehen lassen sollten. Vielleicht trägt ja die flippige Inszenierung dazu bei, dass auch Opernneulinge jüngeren Alters Geschmack an dem herrlichen Stück finden. Das wünsche ich mir jedenfalls!
Musikalische Leitung Anthony Bramall
Regie Bernd Mottl
Bühne Friedrich Eggert
Kostüme Alfred Mayerhofer
Licht Michael Heidinger
Choreinstudierung Pietro Numico
Dramaturgie Daniel C. Schindler
Rodolfo Lucian Krasznec / Arthur Espiritu
Schaunard Liviu Holender / Christoph Filler
Marcello Matija Meić / Mathias Hausmann
Colline Levente Páll / Christoph Seidl
Benoît Martin Hausberg
Mimì Camille Schnoor / Suzanne Taffot
Musetta Mária Celeng / Jasmina Sakr
Parpignol Stefan Thomas
Alcindoro Holger Ohlmann
Sergeant Thomas Hohenberger
Zöllner Martin Hausberg
Chor und Kinderchor und Statisterie des Staatstheaters am Gärtnerplatz
Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz
weitere Termine
Do 04.04.2019 19.30 Uhr
Sa 06.04.2019 19.30 Uhr
Fr 10.05.2019 19.30 Uhr
Mi 29.05.2019 19.30 Uhr
So 09.06.2019 18.00 Uhr
Do 11.07.2019 19.30 Uhr
Sa 13.07.2019 19.30 Uhr
Do 18.07.2019 19.30 Uhr
Ähnliche Artikel
ottifanta am 26. März 2019 23:26  ®ottifanta Eva Lüdi Kong studierte Sinologie in Zürich und klassische Literatur und Kalligraphie in China. Von 1990-2016 lebte sie in China und wurde 2017 für die Neuübersetzung des chinesischen Klassikers Die Reise in den Westen mit dem Übersetzer-Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Im Herbst 2018 erschien ihre Übersetzung des sogenannten 1000 Zeichen Klassiker.
Dieses Buch lese sich fast wie ein dadaistischer Text, sei in einer sehr komprimierten Schriftsprache verfasst und nur mit sehr tiefen Kenntnissen der chinesischen Kultur und Sprache zu verstehen. In China kenne praktisch jeder dieses Buch und könne daraus zitieren. Noch vor gut einem Jahr habe sie nicht gedacht, dass eine Übersetzung zustande kommen könne, dann sei plötzlich alles sehr schnell gegangen. Sie habe das kleine Büchlein nochmal in die Hand bekommen und plötzlich einen Zugang dazu gefunden, es sei ganz wunderbar.
Einige Stelle habe sie als poetisch empfunden, andere beim ersten Lesen nicht direkt verstanden. Doch später habe sie auch diese Stellen spontan verstanden, was jemand mit diesem oder jenen Zeichen ausdrücken wollte. Ganz von selbst hätten sich passende deutsche Sätze ergeben, die meist viersilbig seien.
Während eines Mailkontakts mit ihrem Lektor bei Reclam habe sie einen Auszug mitgeschickt, nur so und er sei direkt im Januar 2018 auf sie zugekommen, dass man es sofort machen könne. Wie schon Die Reise in den Westen habe ihr auch diese Übersetzung viel Spaß gemacht, auch es hier eine kürzere Zeit gewesen sei, habe es sie sehr bereichert. Sie könne natürlich nicht mit den Gelehrten aus der Ming und Qing-Dynastie mithalten, wenn es um solche reiche Texte gehe.
Ihr Schwiegervater aus Hangzhou sei einer der letzten gewesen, der noch eine traditionelle Schule besucht habe und den 1000 Zeichen Klassiker schon mit neun Jahren auswendig lernen musste. Inzwischen lebe er in einem Häuschen auf dem Land und könne noch heute das Buch aus dem Gedächtnis von Hand schreiben, es stecke einfach in ihm drin. Bis zur Übersetzung dieses Buches habe sie nie ein Gesprächsthema mit ihm gehabt, das über allgemeine Dinge hinausging. Jetzt seien sie das erste Mal richtig ins Gespräch gekommen und es sei ein sehr intensiver Austausch gewesen. Für ihn war es wir ein Kinderlied, das man auswendig lernte. Vieles habe er erst viel später als Erwachsener verstanden.
 ®Reclam Der 1000 Zeichen Klassiker entstand im sechsten Jahrhundert und habe rasch zum Kanon der Klassiker gehört. Bis Anfang des 20. Jahrhundert kannte es jeder, der Lesen und Schreiben gelernt hatte. Heute werde es wieder gelehrt, in einer bunt illustrierten Ausgabe für die Schulen. Sie selbst ist fasziniert von der alten Version mit schwarz-weißen Illustrationen. (Leseprobe mit Illustrationen)
Es beginne wie so viele Bücher mit dem Himmel und der Erde, man sehe beim Lesen die gelbe Erde vor sich. Es sei unheimlich poetisch und beim Lesen würden sich Bilder ausbreiten, während die Schüler den Text in den Schulstuben geleiert wiedergaben. Das repetitive Lernen sei Anfang des 20. Jahrhunderts Verruf gekommen und das Werk selbst als „abtötende Literatur“.
Der Kaiser Wu aus der Liang Dynastie habe im sechsten Jahrhundert in der Gegend um Nanjing gelebt, viele Gelehrte um sich geschart und sich sehr für den Buddhismus eingesetzt. Damals mussten Kalligraphen während der Ausbildung einzelne Schriftzeichen von Stelen abschreiben, oft ohne größeren Sinn. Der Kaiser wollte einen zusammenhängenden Bildungstext für die Adelssprösslinge und wählte den Hofgelehrten Zhou Xingsi aus, der in seinen Augen großes Talent hatte. Es sollten 1000 Zeichen vorkommen, keines durfte sich wiederholen. Der Legende nach habe Zhou Xingsi die ganze Nacht gereimt und den Text bereits am nächsten Tag dem Kaiser übergeben.
Ein Mönch habe Ende des sechsten Jahrhunderts 800 Abschriften des Textes in Tempeln in der Provinz Zhejiang verteilt, die in der Nähe von Nanjing liegt Der Text sei überall als Vorlage zum Schreiben lernen verwendet worden. Eva Lüdi Kong zeigte zahlreiche Bilder von alten Lehrbüchern und auch von Bibliotheken, in denen die Zeichen des Buches fortlaufend zur Nummerierung verwendet wurden, z.B. beim vollständigen buddhistischen Kanon.
Ihre Begeisterung für den Text und dessen Tiefe war deutlich spürbar, besonders, wenn sie einzelne Textstellen auf Chinesisch und Deutsch rezitierte. Umso intensiver sie sich mit dem Text beschäftigte, umso mehr sei sie in einen Flow gekommen, jedes Zeichen gehe auf wie eine Blume. Sie habe befürchtet, dass Sinologen ihre Version in Zweifel stellen würden, aber ihr Eindruck sei, dass sie nicht mehr geschrieben habe, als in dem Text, den Zeichen drinstecke und wollte ihren deutschen Lesern dieses besondere Gefühl beim Lesen vermitteln.
Das Werk sei in verschieden Abschnitte unterteilt. Erst werde geschildert, was es im Himmel und auf der Erde gebe, dann gehe es um chinesische Mythen und später um die Weisheit des chinesischen Urkaisers. Es geht um einen Verhaltenskodex für die Menschen, wie Männer und Frauen sich zu verhalten haben. Das Werk sei an sich erzkonfuzianisch (mit einer einzigen Anspielung auf den Buddhismus) und sie frage sich, ob es gut sei, diesen Text heute wieder in Schulen rezitieren zu lassen. Es gebe eine neue Diskussion um den Sinn der Lektüre, ob es nicht doch abtötende Literatur sei.
Dann schweife der Blick auf den Kaiserhof, was dort passiere und wer dort lebe, die Verwaltungsstruktur und die Bekleidung der hohen Beamten. Zu jedem Abschnitt wurden Seiten aus älteren Versionen des Werks gezeigt, mit Text und zahlreichen passenden Illustrationen. Der Autor habe auch einen kritischen Blick auf das Leben am Hofe geworfen und riet z.B. sich vor Intrigen zu hüten.
Ohne den Text genau zu kennen, könne man ihn rein akustisch kaum verstehen, so verknappt und klassisch sei die Sprache. Ihr Schwiegervater habe als Kind einiges anders verstanden, in der Schule wurde mehr Wert auf das Auswendiglernen und Schreiben gelegt als auf eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Inhalt.
Das Ende sei sehr unterschiedlich interpretiert worden. Sie habe es so gelesen, dass der Autor darstellt, wie er mit dem fertigen Manuskript durch den Palastgarten schlendere und es dem Kaiser vorlege. Diese Version habe sie bei einem chinesischen Linguisten gelesen und als passend empfunden. Ganz am Ende gehe der Verfasser wieder auf den Himmel und den Lauf der Sterne ein.
Chinesische Sprichwörter bestehen traditionell aus vier Schriftzeichen und viele Zeilen aus dem 1000 Zeichen Klassiker seien als Sprichwörter bekannt. Dann verglich Eva Lüdi Kong noch die Übersetzungen von J. Hoffmann (1840), Erich Hauer (1925) und Barbara Maag (2010/2017), die teilweise sehr unterschiedlich ausfallen.
Es wurde ein Video von Youtube gezeigt, auf dem eine Schulklasse in traditioneller Kleidung den Text (leiernd) rezitiert. Der Umgang bleibe etwas ambivalent. Ihrer Meinung nach solle es gelesen werden, jedoch mit einem kritischen Blick.
Zum Ende beantwortete sie noch einige Fragen aus dem Publikum.
Obwohl der Text rund 1500 Jahre alt ist und es auch im Chinesischen Lautverschiebungen gab, würde der Originaltext sich immer noch reimen.
Es gebe in China kein klassischeres Buch als dieses und zum Glück sei es ihrem Lektor von Reisen durch China bekannt gewesen. Andere Verlage hätten es nicht gekannt und dieses sehr spezielle Nischenprojekt vermutlich auch nicht veröffentlicht. In ihren Anmerkungen auf der linken Seite (rechts stehen immer Originaltext und Übersetzung) sei sie meist auf die Bezüge zu anderen klassischen Schriften eingegangen.
Sie freue sich, dass dank Reclam dieser so besondere Text jetzt auch einer ausführlichen Version für deutsche Leser verfügbar sei und bedankte sich beim anwesenden Publikum.
Ähnliche Artikel
ottifanta am 25. März 2019 23:01 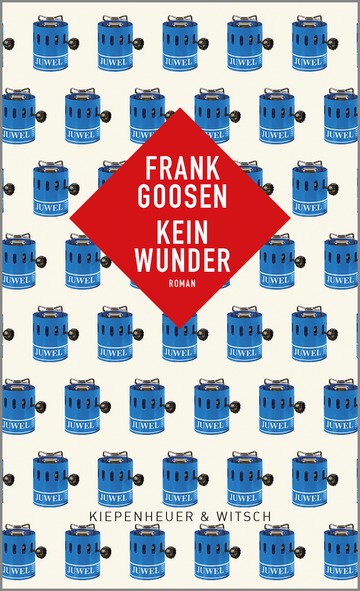 ®Kiepenheuer&Witsch Die Veranstaltung begann mit Frotzeleien über die zahlreichen Schilder auf der Messe mit „… erlesen“. Dabei sei es kein neues, sondern ein altes Trendwort. Noch schlimmer als Kneipen mit Namen wie „Blumenbar“ und „Wunderbar“ fände er Wortspiele mit „Haar“ bei Frisörsalons, wie zB. „Haarmony“ usw.
Die Moderatorin Doris Akrap hatte sich bei Wikipedia über Frank Goosen informiert und schnell stellten die beiden fest, dass die Informationen weder vollständig noch alle korrekt sind. Sein Vater hatte einen Elektrobetrieb und wird erwähnt, seine Mutter machte die Buchhaltung und wird nicht erwähnt. Außerdem fehle seine Omma (sic) im Wikipediaeintrag, dabei sei sie für ihn besonders wichtig gewesen. Sie lebte länger als seine Eltern. Bis 1985 habe sie eine Dienstwohnung im Bochumer Rathaus gehabt und von ihr habe er das Quasseln gelernt. Bis 1985 musste er weder Papier noch Büromöbel kaufen, das habe dort einfach so rumgestanden. Bei ihrem Auszug habe sie die Badewanne mitgenommen, die Stadt habe dann direkt Kopierer reingestellt. 2010 habe er bei einem Besuch dort noch die gleichen Prilblumen auf den Kacheln und den orangefarbenen Rasiererhalter seines Großvaters gesehen.
Bei der Band „Vatermörder“ habe er nur zwei Mal zufällig mit ihnen auf der Bühne gestanden – sei jedoch nie Bandmitglied gewesen. (Das steht inzwischen nicht mehr bei Wikipedia.) Dafür sei er stolzes Mitglied der Deutsche Akademie für Fußball-Kultur und gehöre zur Jury für die Sprüche des Jahres von denen er gleich ein paar seiner Lieblinge zitierte. (z.B. Manuel Neuer „Wir schießen so wenig Tore, vielleicht heißen wir deshalb auch die Knappen.”) Über den deutschen Fußball zwischen 1933-45 rede keiner, daher wüssten auch die wenigsten, dass der VfL Bochum 1938 durch die Zusammenlegung von drei Vereinen entstand sei – damit die Gauhauptstadt Bochum auch einen großen Fußballverein habe.
Über die sieben Jahre im Vorstand des VfL Bochum könne er aus juristischen Gründen nicht viel erzählen, müsse einen Roman darüber schreiben, in dem alles erfunden sei. Es sei im Fußball alles so absurd geworden, nicht nur bei den großen Vereinen. In den Vorstand sei er aufgrund eines Anrufs gekommen, ob er bereit sei, auch Verantwortung zu übernehmen, nachdem er sich sehr kritisch über den Verein geäußert hatte.
Auf die Verfilmung seiner Bücher angesprochen, wollte Frank Goosen lieber über vor 2018 entstandenen Filme sprechen. „Liegen lernen“ von 2003 sei ein sehr schöner Film, „Sommerfest“ habe ihm gut gefallen und zu „So viel Zeit“ (2018) meinte er mit einem Augenzwinkern, es sei ein tolles Buch.
„Tresenlesen“ sei durch einen Zufall entstanden. Jochen Malmsheimer habe in einer bestimmten Kneipe gesessen und zu fortgeschrittener Stunde aus einem Roman von Flann O’Brien vorgelesen, wozu er von Harry Rowohlt inspiriert wurde. Am dritten Abend seien es von Robert Gernhardt inspirierte Texte gewesen und später auch eigene Texte. Nach Frank Goosens Meinung gebe es niemanden, der so mit Sprache umgehe wie Jochen Malmsheimer und er habe die Zusammenarbeit sehr geschätzt.
 ®CK Bei der WDR-Serie „Unser Land in den 80ern“ sei es um die Suche nach der Seele des Ruhrgebiets gegangen. Der Titel sei nicht von ihm gewesen. Er sei quer durch das Land gereist, habe alte und neue Orte besucht, die unterschiedlichsten Menschen getroffen und bedauere es immer, dass viel zu selten im Fernsehen Menschen auftauchen, die „Pott sprechen“. Ein Freund https://de.wikipedia.org/wiki/David_Schraven von ihm werde gelegentlich für die „Tagesthemen“ interviewt und habe die Erfahrung gemacht, dass er unterschätzt werden, wenn er „Pott spreche“. Gerade deshalb würde er es immer wieder gezielt einsetzen.
Dann ging es um sein neues Buch Kein Wunder, in dem die aus Förster, mein Förster bereits bekannten Figuren im Mittelpunkt stehen, Fränge, Brocki und Förster, allerdings schon Jahrzehnte früher. Schauplatz sind Bochum und Berlin im Jahr 1989. Fränge sei ein hedonistischer Typ, lebe in Berlin, weil es uncool sei, untauglich zu sein. Also tue Fränge so, als ob er aus Widerstand in Berlin lebe, wo er eine Freundin im Westen habe und eine im Osten. Daher sei Fränge gegen einen möglichen Mauerfall. Frank Goosen wollte im Ruhrgebiet in jener Zeit in einen größeren Zusammenhang stellen und zeigen, dass der Mauerfall auch Auswirkungen auf das Leben im Westen auswirkte.
Mitte/Ende der 80er Jahre sei das Ruhrgebiet dabei gewesen, fast cool zu werden. Es seien immer mehr Filme im Ruhrgebiet gedreht worden, es habe immer mehr Freizeitangebote gegeben, wie z.B. Tour de Ruhr. Werner Schmitz aus Bochum habe ungewollt die Regionalkrimis erfunden, dabei wollte er nur über etwas schreiben, das er gut kenne.
In den 80ern seien viele von der ZVS an die Ruhruni in Bochum geschickt worden, wo es damals rund 40.000 Studenten gab. Sicher sei die Architektur nicht so pralle, aber es gebe eine super Kneipenszene rund um das Bermudadreieck, gute Theater usw. In den 80ern habe man in Bochum seine Freundin ins Theater eingeladen, nicht ins Kino. So habe er manche Stücke mehrmals gesehen, stets in anderer weiblicher Begleitung. So seien viele positiv von Bochum überrascht gewesen, auch wenn die Uni selbst komplett aus Beton sei. Die Geisteswissenschaften seien damals schon schwarz-gelb angemalt gewesen, dabei habe gerade diese Farbkombination nichts mit Geisteswissenschaften zu tun. (Dieser Witz musste einigen im Publikum erklärt werden :grin)
In seinem neuen Roman habe er bewusst die gewisse gemeinsame Kaputtheit von Ostberlin und einigen Stadtteilen in Bochum genutzt. Während Brocki Ostberlin für das Reich des Bösen halte, aus dem bestimmt jeder weg wolle, idealisiere Fränge es etwas wegen seiner Freundin. Förster stehe in der Mitte und versuche, sich unvoreingenommen anzunähern.
Die Kaulsdorfer Seen als Schauplatz habe ihm ein Bekannter empfohlen, weil viele Häuser dort älter als die DDR waren, meist aus den 1920er Jahren und es so gewisse Gemeinsamkeiten zwischen Berlin und Bochum gebe. Die meisten im Roman genannten Kneipen gebe es in Bochum tatsächlich, nur eine habe er erfunden.
Die Herkunft der Figuren in „Kein Wunder“ sei sehr unterschiedlich, daher könne er durch sie auch verschiedene Perspektiven darstellen. Er selbst sei Menschen wie Förster erst auf dem Gymnasium begegnet. Dort habe er oft das Gefühl gehabt, in der Mitte zu stehen, irgendwie außen vor zu sein und weder zu den einen noch den anderen zu gehören. Seiner Meinung nach die typische Situation eines Aufsteigers in den 70er Jahren. Doris Akrap merkte an, dass diese Perspektive in Wenderomanen selten sei.
Er habe einen Freund gefragt, was man mit den 25 Mark Zwangsumtausch in der DDR kaufen konnte und eventuell gewinnbringend in der BRD verkaufen. So sei er auf den Juwel-Campingkocher gekommen, der mit Benzin betrieben wurde und bekam auch ein Exemplar, das noch fabrikneu eingepackt war, mit eingestanztem Produktionsdatum. Dieses Datum liege genau 30 Jahre vor dem Erscheinungstag von „Kein Wunder“. Das sei nicht so geplant gewesen, sondern zufällig durch eine Produktionsverzögerung so gekommen.
Zum Abschluss wünschte Doris Akrap Frank Goosen und seinem neuen Roman viel Erfolg.
Das Hörbuch ist auf meinem Wunschzettel gelandet.
Ähnliche Artikel
ottifanta am 24. März 2019 23:33
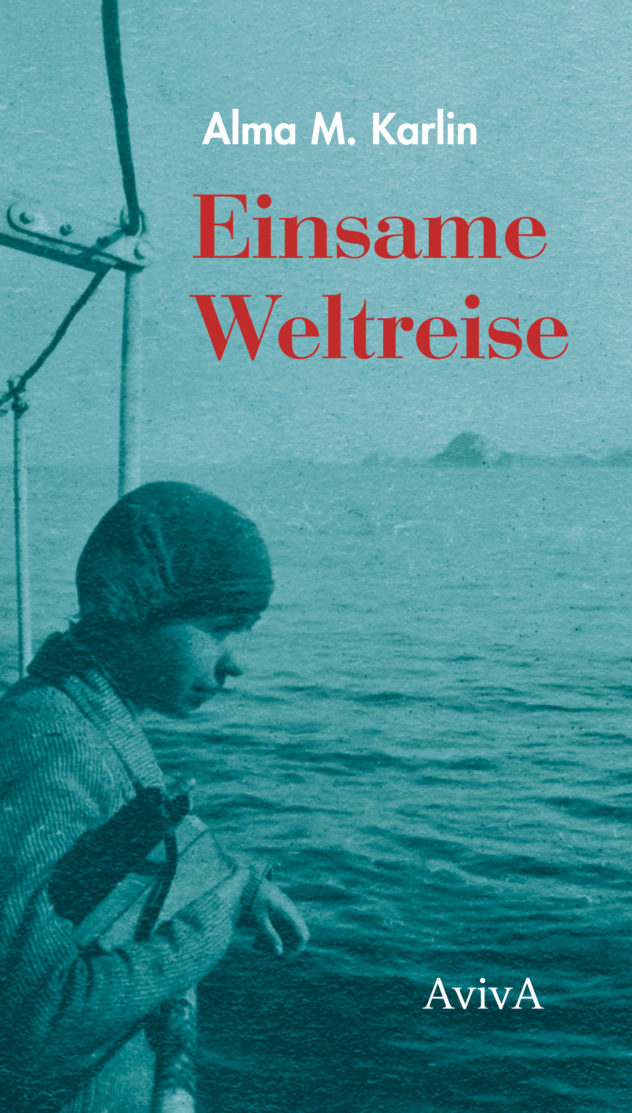 © Aviva Verlag Ohne die Veranstaltung bei der taz wäre ich vermutlich nie auf das neu entdeckte Einsame Weltreise der bereits 1950 verstorbenen Alma Karlin aufmerksam geworden.
Doris Akrap moderierte die Veranstaltung mit Jerneja Jezernik (Verlegerin) und Britta Jürgs (Herausgeberin) vom Aviva Verlag.
Alma Karlin wurde 1889 in Cilli geboren, damals Teil Österreich-Ungarns, heute slowenisch, und gehörte zur deutschsprachigen Minderheit. Von Geburt an halbseitig gelähmt, werden ihr nur geringe Überlebenschancen gegeben. Sie bereiste alleine die Welt und starb 1950 verarmt, zurück in Cilli.
Jerneja Jezernik war fasziniert von dieser vielseitig interessierten Frau, die zu den zehn größten Weltreisenden gehörte. Als erste Frau war sie von 1919 bis 1927 insgesamt 8 ½ Jahre alleine am Stück unterwegs, verfügte über geringe finanzielle Mittel, stammte aus kleinbürgerlichen Milieu. Alma Karlin besaß eine Schreibmaschine namens Erika und wollte schreiben. In Cilli war sie zweisprachig aufgewachsen, sprach Deutsch als Muttersprache und Slowenisch. Auf ihren Reisen konnte sie meist gut mit den Menschen vor Ort kommunizieren, weil sie noch zahlreiche weitere Sprachen lernte, wie z.B. Russisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, sowie Sanskrit, Chinesisch und Japanisch.
Nach der Besetzung ihrer Heimat durch Deutschlang wurde sie als eine ersten verhaftet, später versteckte sie Dissidenten. Nach dem zweiten Weltkrieg war die deutsche Sprache wegen der Nazis verpönt und sie half vielen Flüchtlingen. Erst nach der Unabhängigkeit Sloweniens kam es zur Wende und sie gehört wieder zum Kanon der slowenischen Literatur, auch wenn manche sie nicht als slowenische Autorin gelten lassen wollen, weil sie auf Deutsch schrieb. In der sozialistischen Föderation Jugoslawien spielte Alma Karlin keine Rolle und geriet etwas in Vergessenheit.
Heute ist sie in ihrer Heimat hochaktuell, obwohl ihr Werk ins Slowenische übersetzt werden muss, spricht die Jugend an und inspirierte Filme und Zeichentrickfilme. Die slowenische Post widmete ihr eine Sondermarke. Zwischen den beiden Weltkriegen war sie die meistgelesene Reiseschriftstellerin.
Das Manuskript ihrer Autobiographie Ein Mensch wird liegt in Ljubljana in der Nationalbibliothek, wo Jerneja Jezernik es las. Dieses Buch ist ebenfalls im Aviva Verlag erschienen.
Britta Jürgs war sofort interessiert an der slowenischen Reiseschriftstellerin. Bei der Lektüre ihrer Bücher gefiel ihr die Sprache und Alma Karlins Blick auf die Welt. Ihr lakonischer Stil habe sie sofort gepackt.
Doris Akrap merkte an, dass Alma Karlin mit sich selbst sehr hart ins Gericht gegangen sei, wenn sie ihr Verhältnis mit der Welt und ihrem Körper beschreibt. Die Ärzte erwarteten nicht, dass sie älter als 12/13 Jahre werden würde und ihrer Mutter wurde die Schuld für die Behinderung der Tochter gegeben, weil sie bei der Geburt bereits 45 Jahre alt war.
Alma Karlins Motivation zur so genannten einsamen Weltreise sei u.a. gewesen, es der Welt zu zeigen. Sie sei oft verliebt gewesen, immer in Männer, die hochintellektuell waren, oft Künstler, körperliche Liebe sei ihr jedoch nicht möglich gewesen, für die Kunst wollte sie rein bleiben. Der Kontakt zu Künstlern habe ihr viel gegeben, aber auch zu vielen traurigen Momenten in ihrem Leben geführt.
Weil es immer wieder Schwierigkeiten mit den Visa gab, konnte sie nicht alle Länder besuchen, die sie gerne gesehen hätte. Das Visum für Japan erhielt sie ohne Probleme und es wurde ein Auszug aus ihrem Bericht über den Aufenthalt dort vorgelesen.
Britta Jürgs wurde bei der Lektüre bewusst, wie gefährlich es damals für alleinreisende Frauen war, erst recht, wenn man sich nur einfache Unterkünfte leisten konnte. Alma Karlin musste immer wieder unterwegs Geld für die nächste Etappe verdienen. In Südamerika machte sie schlechte Erfahrungen mit anderen Menschen, wurde ausgeraubt. Mit der Zeit sei sie bitter geworden. Auf der anderen Seite habe sie von Frauen dort eine unglaubliche Solidarität erfahren und es sei immer wieder deutlich, dass sie mit den falschen Erwartungen einer Europäerin auf die Reise ging.
Jerneja Jezernik (deren wunderbares und fast akzentfreies Deutsch sehr beeindruckend war), kann sich kaum vorstellen, wie es damals für Frauen war, alleine durch die Welt zu reisen. Heute sei eine junge Frau (deren Namen ich leider nicht verstand) auf den Spuren von Alma Karlin unterwegs, aber gemeinsam mit ihrem Freund. Derzeit sei sie in Hawaii und interviewe viele Frauen, wie es vor 100 Jahren für eine Alleinreisende gewesen sein könne.
Für Britta Jürgs war es interessant zu lesen, wie offen und gleichzeitig europäisch Alma Karlin ist, offen mit eurozentrischem Blick ging sie in die Welt, nicht nationalistisch für ihr Herkunftsland und stellte sich gegen die Vorurteile anderer reisender Frauen in Amerika. Natürlich sei auch sie nicht frei von Vorurteilen gewesen, war Kind ihrer Zeit und nachdem sie in Peru schlechte Erfahrungen mit Männern machte, habe sie besonders rassistische Ausdrücke für die Männer von dort verwendet.
In Japan hingegen sei sie als Frau gleichwertig gewesen, habe sich voll akzeptiert gefühlt und gleichzeitig selbst als minderwertig empfunden.
Ihre zeitgenössischen Leser hätten ihre Berichte nicht als rassistisch empfunden, dafür bemängelt, dass sie judenfreundlich schreibe, sei die Wahrnehmung heute genau umgekehrt.
In ihren Berichten ist zu lesen, dass Mischehen und deren Kinder damals weltweit nicht erwünscht waren und aus der jeweiligen Gesellschaft ausgestoßen wurden. In unserer globalisierten Welt habe sich das gewandelt.
Das Manuskript der Autobiographie tippte Jerneja Jezernik ab und hörte vom Bibliothekar, dass das Material von Alma Karlin zu den meist erforschten und ausgeliehenen gehört.
In ihren Büchern gebe es sowohl feministische Aspekte und es werde spekuliert, ob sie homosexuell war, weil sie mit einer Freundin zusammenlebte. Ihre ganze Persönlichkeit sei so mannigfaltig, passe in kein Regelfach und spreche daher sehr viele Menschen an.
Dann wurde der Anfang ihrer Autobiographie vorgelesen, in der Alma Karlin selbstironisch schildert, dass ihre Verwandtschaft es als Segen empfand, dass sie Einzelkind blieb und von ihren Plänen für die Reise nach Japan. Sie bezeichnete sich selbst als „Zusammenkratzerl“ aufgrund ihrer mehrfachen Behinderung.
Jerneja Jezernik arbeitet an einer Biographie über Alma Karlin und versucht, deren komplexe Persönlichkeit zu verstehen. Zur Freude von Britta Jürgs direkt auf Deutsch, denn es sei schwierig eine Biographie über eine deutschsprachige Schriftstellerin aus dem Slowenischen zu übersetzen.
Zum Abschluss lud Jerneja Jezernik die Anwesenden ein, im Frühjahr oder Herbst nach Slowenien zu reisen oder literarisch auf die Spuren von Alma Karlin die Welt zu erkunden. Doris Akrap freut sich auf mehr slowenische Literatur in der nächsten Zeit, da Slowenien 2020 Gastland der Frankfurter Buchmesse sein wird.
Ähnliche Artikel
|
|















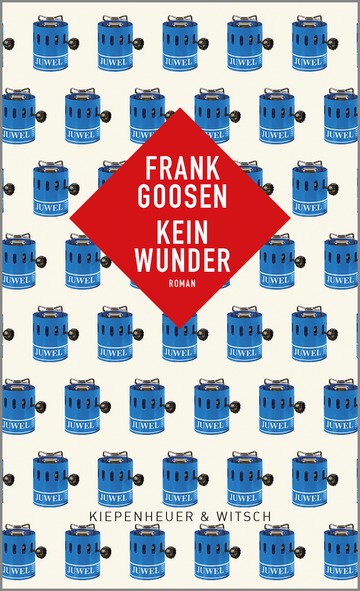

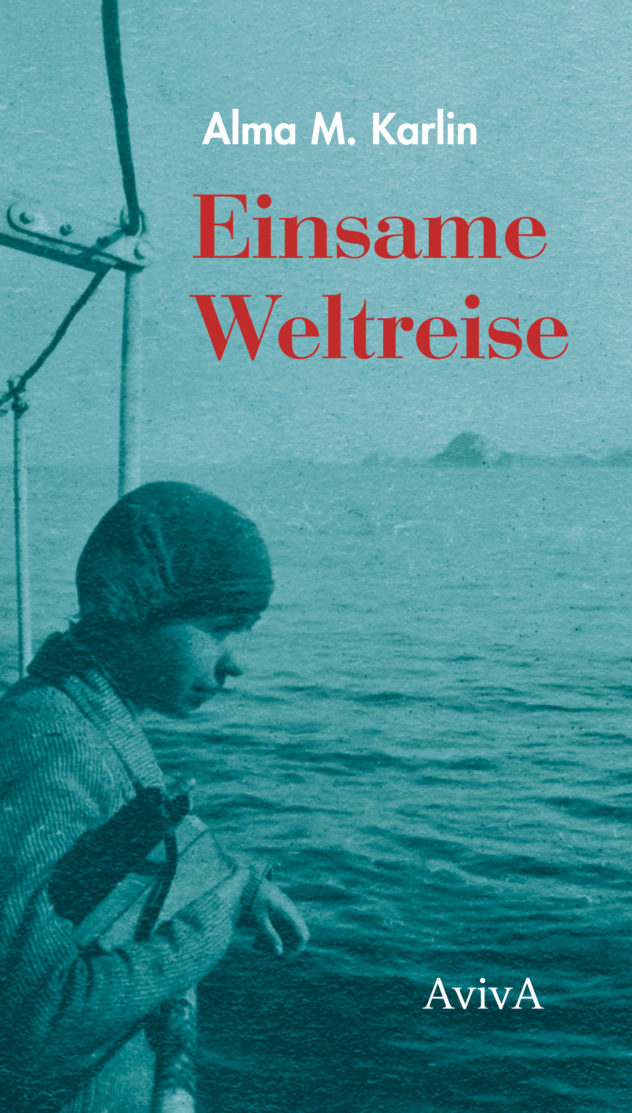

Letzte Kommentare